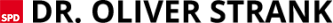TTIP – eine Gefährdung der Souveränität
TTIP ist für viele Menschen ein Eingriff in die nationale Souveränität. Foto: dpa
Ist das Freihandelsabkommen TTIP eine Gefahr für unsere Demokratie? Die intransparenten Verhandlungen werden zu Recht als undemokratisch empfunden. Ausweg könnte ein internationaler Gerichtshof sein. Der Gastbeitrag.
03.03.2015 20:00 Uhr, Oliver Strank
Selten war etwas, das es noch gar nicht gibt, so umstritten. Für den ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Barroso ist TTIP das größte und billigste Konjunkturprogramm aller Zeiten. Einerseits. Demonstranten gegen TTIP skandieren: „TTIP ist böse“. Andererseits. Bereits die intransparenten Verhandlungen zum TTIP werden zu Recht als undemokratisch empfunden. Ob das Demokratieprinzip gewahrt wird, hängt maßgeblich davon ab, ob TTIP am Ende von demokratisch legitimierten Volksvertretern ratifiziert werden muss. Nur dann kann von jener ununterbrochenen Legitimationskette zwischen dem Souverän – den Bürgern Europas – und ihren gewählten Vertretern die Rede sein, die das Demokratieprinzip zwingend voraussetzt. Außer dem EU-Parlament muss in Deutschland auch der Bundestag zustimmen, da TTIP als sogenanntes gemischtes Abkommen zu qualifizieren sein dürfte.
Ratifizierung von Volksvertretern
Wie ein Tropfen Pastis ausreicht, um ein Glas Wasser zu trüben, machen schon einzelne Unterpunkte eines Abkommens das Abkommen als Ganzes von der Zustimmung aller EU-Mitgliedsstaaten abhängig. Dieser Tropfen Pastis dürfte bei TTIP zumindest das umfassende Investitionsschutzkapitel sein. Es beschränkt sich nicht auf reine Handelsfragen, für welche die EU-Kommission in der Tat die ausschließliche Abschlusskompetenz besitzt, sondern greift allein aufgrund seiner Tragweite in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedsstaaten ein. Bundestag und Bundesrat – und alle anderen EU-Mitgliedsstaaten – müssten Ceta und TTIP daher ratifizieren. Dann wäre zumindest in diesem Punkt das Prinzip der repräsentativen Demokratie gewahrt.
Zwar dürfte TTIP als völkerrechtlicher Vertrag vor dem Bundesverfassungsgericht wohl kaum justiziabel sein. Ein entsprechendes Zustimmungsgesetz des Bundestags dagegen schon. Dass die Karlsruher Richter die privaten Schiedsgerichte als verfassungswidrig einstufen, ist kein unrealistisches Szenario. Dann müsste TTIP in diesem Punkt nachverhandelt werden.
Was zum geplanten Investorenschutzkapitel an dürftigen Informationen durchgesickert ist, verheißt nichts Gutes. Privaten Investoren soll das Recht eingeräumt werden, Nationalstaaten unter bestimmten Voraussetzungen vor privaten Schiedsgerichten zu verklagen. Derartige Investor-Staat-Schiedsgerichte (ISDS) sind nicht neu. Es gibt sie seit über fünf Jahrzehnten. Deutschland hat sie zum Schutz der eigenen Investoren erstmals im Jahr 1959 in ein bilaterales Abkommen mit Pakistan hineinverhandelt, hat sie also gewissermaßen erfunden. Es gibt Hunderte bilaterale und multilaterale Freihandelsabkommen, alle geheim verhandelt, die meisten mit Investorenschutz.
Undemokratischer Investorenschutz
Dass es private Schiedsgerichte seit langem gibt, heißt aber noch lange nicht, dass es sie zu Recht gibt. Sein und Sollen können auseinanderfallen. Führt man sich die Tragweite des im TTIP geplanten Investitionsschutzes vor Augen, so stellt sich erst recht die Legitimitätsfrage. Solange sich nur Privatunternehmen gegenseitig vor privaten Schiedsgerichten verklagen können, berührt dies die Demokratie nicht. Problematisch für die Demokratie wird die Sache, wenn auf Beklagtenseite ein Staat steht. Besonders gefährlich für die Demokratie ist der im TTIP angelegte Schutz einer bereits getätigten Investition vor einer indirekten Enteignung durch künftige Gesetzgebung: Für den Fall, dass ein nationales Parlament etwa einen gesetzlichen Mindestlohn beschließt, der geeignet ist, die Gewinnerwartung eines Investors zu schmälern, so ist es nach dem TTIP in seiner jetzigen Gestalt zumindest denkbar, dass der betreffende Staat dem Investor den entgangenen Gewinn zu ersetzen hat.
Gesetze zugunsten des Gemeinwohls und zulasten von Investoren können in Zukunft verdammt teuer für den Steuerzahler werden. Und gegen das entsprechende Urteil kann Deutschland keinerlei Rechtsmittel einlegen. Über jedem Bundestag, der in Zukunft über eine Gesetzesänderung zum Schutz des Gemeinwohls verhandelt, das die Gewinnerwartung von Investoren zu schmälern geeignet ist, schwebt das Damoklesschwert einer drohenden Milliardenklage. In den USA nennt man diesen Effekt „regulatory freeze“ – aus Angst davor, dass bestimmte Gesetze teuer werden können, entscheidet sich das Parlament dazu, sie gar nicht erst zu verabschieden.
Mit dem Demokratieprinzip versöhnen ließe sich der Investorenschutz höchstens, wenn es gelingt, ein ständiges öffentliches Schiedsgericht für Streitigkeiten rund um derartige Freihandelsabkommen einzurichten – eine Art „internationaler Handelsgerichtshof“ nach dem Vorbild anderer supranationaler Gerichtshöfe wie etwa dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag oder dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Ein solcher Handelsgerichtshof müsste öffentlich-rechtlich institutionalisiert mit Berufsrichtern besetzt werden, die demokratisch legitimiert sind. Er müsste Rechtsmittel zulassen, damit seine Entscheidungen überprüfbar und korrigierbar sind. Und die Verhandlungen eines solchen Gerichtshofs müssten vor den Augen der Öffentlichkeit stattfinden, damit seine Urteile im Namen des Volkes gesprochen werden.
Es ist noch nichts entschieden. Wir Bürger Europas müssen uns nun die 1600 Seiten des veröffentlichten Ceta-Abkommens sehr genau anschauen, um über eine breite öffentliche Debatte in den Bundestag hinein endlich Einfluss auf die endgültigen Vertragstexte von Ceta und TTIP zu nehmen. Oder eben dafür zu kämpfen, dass die Abkommen platzen.
Oliver Strank arbeitet als Rechtsanwalt in Frankfurt. Er war UN-Referendar und ist Experte für Völkerrecht.